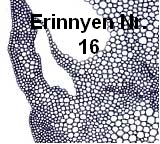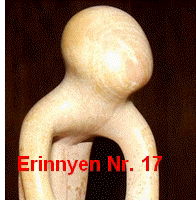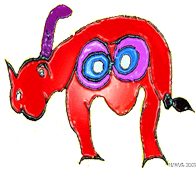![]()
August 2004
Gerald M. Edelman / Guilio Tononi:
Gehirn und Geist.
Wie aus Materie Bewusstsein entsteht.
Aus dem Englischen von Susanne Kuhlmann-Krieg. Mit 40 Abbildungen, München2004 (dtv).
Wie entsteht Bewusstsein? Was sind die neuronalen Korrelate unseres Denkens? Wie sind neuronale Prozesse für die bewusste Erfahrung verantwortlich? Was ist unter subjektiven Erlebniszuständen, z.B. wenn wir rot sehen, die so genannten Qualia, auf neuronaler Ebene zu verstehen? Gibt es einen allgemeinen Zusammenhang zwischen Gehirn und Bewusstsein oder ist dieser Zusammenhang stets individuell? Wer sich mit dem Verhältnis von Geist (allgemeine Bedeutung/immateriell) und Materie beschäftigt hat, wird sich diese oder ähnliche Fragen schon einmal gestellt haben. Sie behandeln eines der wesentlichen Aspekte unseres Menschseins und unseres Weltverständnisses. Es sind nicht nur Fachfragen einer hochspezialisierten Wissenschaft, sondern sie sind von allgemeinem Interesse. Das Besondere an diesem Buch ist seine strenge Wissenschaftlichkeit, die sich darin ausdrückt, dass die Autoren ihre Vermutungen klar als Hypothesen kennzeichnen (was bei einigen Scharlatanen in diesem Gebiet durchaus nicht üblich ist), wissenschaftlich genau argumentieren (soweit es um ihre Fachwissenschaft geht) und ihre Überlegungen auf experimentellen Resultaten basieren. Edelman ist Biochemiker und Mediziner (Nobelpreisträger) und Tononi ist Professor für Psychiatrie. Dennoch können auch sie das Dilemma der Hirnforschung nicht umgehen. Dieses besteht in der Tatsache, dass jede Erforschung der neuronalen Grundlagen unseres Denkens dieses Denken immer schon voraussetzt, ja Hirnforschung selbst schon Denken ist mit allen seinen logischen und anderen Implikationen: Das Gehirn erforscht sicht sozusagen selbst! Insofern gehört diese Wissenschaft nicht nur zu den Naturwissenschaften, sonder auch zum wissenschaftlichen Selbstbewusstsein (Philosophie).
Der Rezensent ist kein Gehirnforscher, seine Darstellung muss deshalb laienhaft in Bezug auf den naturwissenschaftlichen Aspekt bleiben. Dennoch ist eine sinnvolle Besprechung möglich, da die Autoren den Anspruch haben einem breiteren Publikum einen Einblick in die aktuelle Diskussion der Gehirnforschung zu vermitteln. Das geht schon daraus hervor, dass die beiden Gehirnforscher systematisch den Leser in den Stand der Hirnforschung geleiten. Um diese zu verstehen, muss er sich aber etwa 20 wissenschaftliche Fachbegriffe aneignen (die ihm manchmal allzu didaktisch präsentiert werden) und zumindest für ein Kapitel mathematisches Vorwissen mitbringen. Da die Hirnforschung, wie der Titel des Buches verrät, zwangsläufig auch philosophische Fragen behandelt, wird sich unser Schwerpunkt auf diesen Teil legen. Der Rezensent kommt von der Philosophie her und kann dadurch wohl die expliziten philosophischen Thesen und die geheimen philosophischen Implikationen der Autoren beurteilen. Eine dieser Implikationen, die der Rezensent mit den Forschern teilt, ist die selbstverständliche Rationalität, die keine göttlichen Hilfskonstanten benötigt.
Im ersten Kapitel gehen die Autoren auf den so genannten „Weltknoten“ ein, indem sie sich – philosophisch etwas flapsig – sowohl von einen strengen Dualismus, wie sie ihn bei Descartes sehen, distanzieren als auch vom einem „extremen Reduktionismus“, wie er etwa bei Thomas Huxley vorkommt, abwenden. Im Folgenden wird der Leser in die Struktur des Gehirns eingeführt, es werden die neuronalen Aktivitäten beschrieben, die Basis des Denkens und anderer Vorgänge im Gehirn sind. Auch auf die Selektion in der Evolution wird eingegangen und bestimmt, was Wahrnehmung und „Erinnerte Gegenwart“ neuronal heißen kann bzw. heißen könnte. Die Autoren unterscheiden ein primäres Bewusstsein, wie es auch bei den höheren Säugetieren vorhanden ist, und ein höheres Bewusstsein, das an symbolisierte Gedanken gebunden ist wie Begriffe, Wertvorgaben, Selbstbewusstsein und Gedächtnis, die auf diesen Begriffen beruhen. (S. 140 ff.) Dieses höhere Bewusstsein kommt nur den Menschen zu und war ein Selektionsvorteil in der Geschichte der Evolution. Nach diesen grundlegenden Darstellungen entwickeln die Autoren ihre Vorstellung von einem neuronalen Korrelat des menschlichen Bewusstseins.
„Bewusstsein ist weder ein Ding noch eine einfache Eigenschaft.“ (196) Seine neurale Basis ist nicht diese oder jene Gehirnregion, sondern ein „funktionales Cluster“, d.i. ein verzweigtes Netz von neuronalen Zusammenhängen, das sich ständig ändert, also dynamisch ist, und hoch komplex sein muss. Der Grad der Komplexität, ein Begriff, der oft ausdrückt, dass man nichts Genaues weiß, aber von den Autoren genau bestimmt ist, dieser Grad der Komplexität ist entscheidend, ob der Mensch sich etwas bewusst wird oder nicht.
„Wir bezeichnen einen solchen Cluster von binnen Sekundenbruchteilen stark untereinander wechselwirkenden Neuronengruppen mit distinkten Funktionsgrenzen gegenüber dem übrigen Gehirn als ‚flexibles oder dynamisches Kerngefüge’ (dynamic core), womit gleichzeitig seine Integriertheit und seine konstant veränderliche Zusammensetzung betont werden soll. Ein flexibles Kerngefüge ist somit ein Prozess, keine Ding oder Ort, und definiert ist es über seine neuralen Wechselwirkungen, nicht über eine besondere neurale Lokalisierung, seine Verknüpfung oder Aktivität. Zwar wird es über eine gewisse räumliche Ausdehnung verfügen, aber diese wird in der Regel nicht fest umrissen sein, sich in ihrer Zusammensetzung unablässig ändern und daher nicht an einem einzigen Platz im Gehirn dingfest zu machen sein. Außerdem, so unsere Voraussage, wird ein funktionaler Cluster mit solchen Eigenschaften nur dann mit dem Entstehen bewusster Erfahrung assoziiert sein, wenn die in ihm ablaufenden reentranten Interaktionen von hinreichender Differenziertheit sind, dies wiederum schlägt sich in seiner Komplexität nieder.“ (197)
Dieses flexible Cluster hat seinen Sitz vor allem im Großhirn und dem Thalamus. Ein weiteres Merkmal dieses funktionalen Clusters ist seine Privatheit. Zwar sind bestimmte Vorgänge wie z.B. Sehen an feste Neuronen gebunden, aber ein funktionales Cluster soll keine Person mit einer anderen teilen. Hinzu kommen noch die Merkmale der Kohärenz der Bewusstseinszustände, die so etwas bewirken wie die „Einheit des Bewusstseins“ (200), ein hoher Informationsgehalt bewusster Erfahrung, eine globale Verfügbarkeit von Informationen, eine Flexibilität und die Fähigkeit zu lernen und auf unerwartete Assoziationen zu reagieren. Die Dynamik des funktionalen Clusters führt zu einer seriellen Organisation bewusster Erfahrung, so dass Bewusstsein sich als kontinuierlicher, aber dennoch permanent verändernder Prozess erweist. (208) Dieser funktionale Cluster oder dieses „Kerngefüge“ ist in vielfältiger Weise verbunden mit Gehirnregionen, die unser Langzeitgedächtnis enthalten oder das „spezielle Werte-Kategorie-Gedächtnis im Stirn-, Schläfen- und Scheitellappenarealen“, das vorherige Werteerfahrungen enthält. Ebenso gibt es eine reentrante Beziehung zum Brocaschen Feld und den Wernickesschen Sprachzentrum, die Bereiche, die in unbewussten Routineabläufen uns Begriffe beim Sprechen zur Verfügung stellen. „Unbewusste Routineabläufe können als Folge bewusster Leistungen ineinander verschachtelt oder in Serie geschaltet werden und sensomotorische Schleifen hervorbringen, die zu dem beitragen, was wir als Globalkartierungen bezeichnet hatten.“ (241) Eine solche Beziehung besteht auch zwischen dem Bewusstsein und den Teilen des Gehirns, welche die motorische Routine der Bewegung in Gang halten.
Haben Tiere nur ein primäres Bewusstsein, das aus reentrant verkoppelten Schleifen zur Verknüpfung des „Werte-Kategorien-Gedächtnisses“ mit der aktuellen „Wahrnehmungskategorisierung“ besteht, so hat der Mensch ein Bewusstsein höherer Ordnung, das vor allem auf der Fähigkeit zu symbolischen Bedeutungen und Semantik begründet ist. „Wie im Falle des primären Bewusstseins bildete auch bei der Evolution von Bewusstsein höherer Ordnung die Entwicklung eines besonderen Systems von reentranten Verknüpfungen – dieses Mal zwischen den für Sprache zuständigen Gehirnsystemen (...) und den bestehenden begriffsbildenden Regionen des Gehirns – ein Schlüsselereignis. Die Entstehung dieser neuralen Verknüpfungen und das Erscheinen von Sprache machten eine Bezugnahme auf innere Zustände, Gegenstände und Ereignisse mit Hilfe von Symbolen möglich. Die Aneignung eines ständig wachsenden Lexikons so gearteter Symbole vermittels sozialer Interaktionen – die sich übrigens ursprünglich vermutlich auf die pflegende, emotionale Beziehung zwischen Mutter und Kind gründeten – ließ innerhalb eines jeden individuellen Bewusstseins die Unterscheidung des eigenen Selbst möglich werden. Mit dem Aufblühen erzählerischer Fähigkeiten und deren Einfluss auf das linguistische und begriffliche Gedächtnis bildete das Bewusstsein höherer Ordnung den Nährboden für einen Begriff von Gegenwart und Zukunft in Bezug auf dieses Selbst und das anderer.“ (264 f.) Wenn die Serie der funktionalen Cluster nicht ein durch biologische, vom Gehirn ausgehende oder von der Außenwelt durch Stimuli verursachtes Chaos sein soll, dann muss es so etwas wie Kontinuität, Erinnerung, Gegenwartsbewusstsein und Planung in die Zukunft hinein geben. Dies setzt aber ein steuerndes Subjekt voraus, auf wie viel Routineabläufe es sich auch immer stützen kann. Beim Tier mit primären Bewusstsein beruht dies vor allem auf Instinkt und lebensgeschichtlich akkumulierte Routinehandlungen. Beim Menschen tritt aber ein Bewusstsein höherer Ordnung hinzu. Es bildet sich ein Subjekt dieser Kontinuität, ein Ich-Bewusstsein oder Selbst heraus. Im Gegensatz zu Wolf Singer, der in solchen Begriffen nur Illusionen unseres Gehirns sieht, setzen die Autoren zurecht eine solches Selbst voraus und erklären es mit der begrifflichen Fähigkeit des Gehirns, die es ermöglicht, innere Zustände zu benennen und damit zu unterscheiden.
„Mit dem Auftreten von Bewusstsein höherer Ordnung durch Sprache kommt es zu einer bewusst erlebten Kopplung von Gefühlen und Werten, die in Emotionen münden, deren kognitive Komponenten von der betreffenden Person – dem Selbst – erfahren werden. Wenn diese Kopplung stattfindet, werden die bereits komplexen Ereignisse des mentalen Lebens I mit jenen des noch komplexeren mentalen Lebens II verquickt. Daraus ergibt sich eine wahre Subjektivität von narrativen und metaphorischen Fähigkeiten mit Konzepten wie Selbst, Vergangenheit und Zukunft, in einem komplexen Geflecht aus Überzeugungen und Wünschen, das ausgesprochen und anderweitig ausgedrückt werden kann. Fiktion wird möglich. (...) Vor diesem Hintergrund der zusätzlichen Macht, die Sprache einem solchen selektiven System verleiht, kann durch die Entwicklung eines bewussten Selbst aus zunächst diffus wirksamen Werten Bedeutung erwachsen.“ (280 f.)
Die wissenschaftliche Basis für diese Hypothesen der Autoren sind einmal die bereits vorliegenden experimentellen Resultate der Hirnforschung, zugleich sollte diese Hypothese, Bewusstsein als ein funktionales Cluster, den Rahmen für weitere Experimente abgeben. Und selbstverständlich geht in die Ansicht der Autoren auch die Selbstbeobachtung von Menschen ein, die ihre Denkprozesse formulieren, etwa in der Psychiatrie, nicht zuletzt die Selbstbeobachtung der Schreiber selbst. Bei allem Fortschritt, den die Hirnforschung in den letzten Jahrzehnten erreicht hat, müssen die Autoren, die den gegenwärtigen Stand dieser Forschung zusammenfassen wollen, sich eingestehen, in entscheidenden Fragen wenig zu wissen. „Was geht in unserem Kopf vor, wenn wir einen Gedanken haben? Trotz aller Fortschritte in den Neurowissenschaften lässt sich die Tatsache nicht leugnen, dass wir die Antwort hierauf noch immer nicht in hinreichender Detailliertheit kennen.“ (273) Insofern ist die Beschreibung des folgenden konkreten Gedankens teilweise realistisch, teilweise hypothetisch und teilweise fiktional. Einer der Autoren, der in seine Küche geht, um etwas zu trinken, wird daran erinnert, dass er noch einkaufen muss. Dies soll sich in seinem Gehirn dabei abspielen:
„Zunächst einmal sind Basalganglien, Kleinhirn und Motorcortex damit beschäftigt, mich in die Küche gehen und unbewusste Routinehandlungen wie das Aufdrehen des Wasserhahns vollführen zu lassen. Während ich mich bewege, senden Globalkartierungen Signale an meinen Körper, meine Arme und Beine, deren ich mir großenteils ebenfalls nicht bewusst werde. Eine Reihe von reentranten Wechselwirkungen zwischen meinen visuellen Karten, meinen Scheitellappen und verschiedenen Stirnlappenarealen sind daran beteiligt, die Zeigerstellung auf dem Ziffernblatt augenscheinlich in Zeit zu übersetzen. Die Aktivität des dynamischen Kerngefüges lässt ein komplexes zusammenhängendes Szenario und gleichzeitig Bilder von meinem Körper erstehen. Ich werde in diesem Augenblick von einer heftigen Wallung erfasst – ein Gefühl leichter Furcht aus dem mentalen Leben I, das auf der Ebene des mentalen Lebens II zu einer Emotion mit allen notwendigen kognitiven Komponenten verdichtet wurde: Furcht: ‚Der Laden könnte bereits geschlossen sein.’ Aufsteigende Bewertungssysteme – der Locus coeruleus, verschiedene Kerne im unteren Stirnhirn, die Raphekerne und der Hypothalamus – schütten eine besondere Neurotransmitterkombination aus, die den jeweiligen Stellenwert der verschiedenen Signale reflektiert. Das Kerngefüge muss die neuralen Konsequenzen dieser Aktivität registrieren – Gefühle, Perzeptionen und Erinnerungen.
An diesem Punkt kommt es vielleicht zu einem expliziten Rückgriff auf die Sprache als Ausdruck wahrhaft subjektiven emotionalen Erlebens: die (womöglich laut ausgesprochene) Feststellung: ‚Verflixt! Ich muss noch einkaufen!’ Mit diesem Satz ist das gesamte System des Sprachgedächtnisses in Aktion getreten und wird innerhalb des Kerngefüges spezifisch an den mit ihm verbundenen Schläfenlappen gekoppelt, der Begriffsfindung halber obendrein an das Stirnhirn und über bestimmte Ausgangsportale wieder mit den Basalganglien, die mich meinen Plan, in die Garage zu gehen, umsetzen lassen, schließlich und endlich lässt der Motorcortex seine Signale folgen.“ (278 f.)
Von der Philosophie ausgehend erscheint der von Edelman und Tononi dargestellte Stand der Hirnforschung mehr oder weniger als irrelevant. Philosophie wie jede Wissenschaft hat es mit allgemeinen Resultaten des Denkens zu tun, die der Logik unterstehen. Logik aber sagt wie wir denken sollen, damit (zumindest formal) Wahrheit möglich wird. Die Psychologie und die Hirnforschung hat es mit dem Fühlen und Denken zu tun, das tatsächlich abläuft. Es ist unwichtig für die Wissenschaft, wie der Strom des Denkens abläuft, wenn nur überhaupt das Denken fähig ist, wissenschaftliche Resultate zu produzieren und zu reproduzieren. Dass es dazu fähig ist, zeigt das bisher angehäufte Wissen. Insofern ist ihre Aussage: „Die Epistemologie sollte ihre Basis in der Biologie haben, insbesondere in der Neurobiologie“, abzulehnen, da sie gegenstandslos ist.
Das Verdienst von Edelman und Tononi ist es zu zeigen, die Hirnforschung birgt keine Argumente, die Rationalität oder den freien Willen ausschließen. Sie begehen nicht den Fehler wie Wolf Singer, von partiellen Erkenntnissen einer Einzelwissenschaft allgemeine Einsichten zu eliminieren (siehe unsere Kritik in: „Gibt es einen freien Willen“). Im Gegenteil fragen die Autoren: Wenn wir Denken, ein Selbstbewusstsein haben, eine Entscheidung fällen, was läuft dann in unserem Gehirn ab. So z.B. ist schon das Empfinden der Farbe Rot unmöglich, ohne eine Entscheidung, die diese Farbe aus einer Vielfalt von anderen Farben auswählt. Denn Rot ist nur erlebbar, wenn es von Grün, Blau, Gelb usw. unterschieden wird. Sind diese Farben in der aktuellen Sinneswahrnehmung nicht vorhanden, dann muss Rot mit anderen Farben im Gedächtnis (oder Vorstellungsvermögen) unterschieden werden. (Ein Mensch, der sein Leben lang nur Rot sähe, könnte gar nicht die Qualität dieser Farbe beurteilen oder empfinden.) „Die subjektive Erlebnisqualität der reinen Rotempfindung entspricht einer Auswahl oder Entscheidung, die unter all den Milliarden möglichen anderen Zuständen innerhalb desselben neuralen Raumes getroffen wurde. Zwar sind Neurone, die auf Rot reagieren, mit Sicherheit notwendig, aber sie sind eindeutig nicht hinreichend. Die bewusste Erlebnisqualität, die dem subjektiven Erleben des Anblicks der Farbe Rot entspricht, erhält ihre volle Bedeutung erst, wenn man sie im entsprechenden, sehr viel größeren neuralen Bezugsrahmen betrachtet. (...) Unserer Hypothese zufolge setzt die Wahrnehmung der Röte von Rot eine definitive Unterscheidung zwischen verschiedenen integrierten Zuständen des gesamten dynamischen Kerngefüges voraus und kann niemals einfach auf magische Weise aus dem Feuern einer einzelnen Gruppe von Neuronen mit gewissen lokal besonderen intrinsischen Fähigkeiten hervorgehen.“ (229)
Da, wo die Autoren sich auf das Gebiet der Philosophie wagen, sind ihre philosophischen Reflexionen teilweise flapsig, teilweise unmethodisch, teilweise als Hypostase biologischer Einsichten zu bewerten. Ihr Biologismus drückt sich vor allem in der Forderung nach einer „biologisch begründete(n) Epistemologie“ (295) aus, wobei „Epistemologie“ „sich mit den Grundlagen und der Rechtfertigung unseres Wissens und unserer Überzeugungen befasst“ (294). Soll darunter mehr verstanden werden, als dass Denken auch auf der Biologie des Gehirns beruht, dann haben sie das entscheidende Problem, wie objektive allgemeingültige Erkenntnisse bestehen können, wenn doch unser Gehirn in einem ständigen Prozess ist, der noch dazu durch individuelle Eigenheiten (Privatheit) gekennzeichnet ist, gar nicht angesprochen. Die grundlegende Frage der recht verstandenen Epistemologie, wie sind synthetische Urteile a priori möglich (Kant), lässt sich nicht mit der Gehirnbiologie beantworten. (Diese könnte, wenn sie denn weiter fortgeschritten ist, lediglich aussagen, warum dieser oder jener Mensch nicht oder noch nicht in Lage ist, etwa höhere Mathematik zu verstehen.) die Autoren trennen in ihrer Argumentation nicht klar zwischen empirisch beobachtbaren Phänomenen und den logischen Voraussetzungen von Wissenschaft. Dies führt zu einem neopositivistischen Skeptizismus, dem alles nur Hypothese, Überlegung, Angedachtes ... ist, dem aber wahre Aussagen fremd sind – obwohl die Autoren Aussagen auch als kategorische präsentieren. Mit anderen Worten sind die philosophischen Konsequenzen, die Edelman und Tononi aus ihrem fachspezifischen Einsichten ziehen, amateurhaft, durch Unwissenheit der philosophischen Tradition gekennzeichnet und dementsprechend nicht auf dem avancierten Stand des philosophischen Denkens, sie sind eben das, zu was sie die Philosophie machen: zum „Hang (...) Fragen nach den letzten Bedeutungen der Dinge zu stellen“ (294).
In ihrem Titel versprechen Edelman und Tononi die Frage zu klären: „Wie aus Materie Bewusstsein entsteht?“ Hier ihre zusammenfassende Antwort: „(...) wie steht es mit dem Geist, der das Denken hervorbringt? Die Antwort lautet, dass dieser gleichermaßen materiell und mit einem Bedeutungsinhalt versehen ist. Für den Geist als Netzwerk von Beziehungen gibt es eine materielle Basis: Das Wirken Ihres Gehirns und all seiner Mechanismen von ganz unten bis nach ganz oben, von den Atomen bis hin zum Verhalten, resultiert in einem Geist, der sich mit Bedeutungen befassen kann. Während dieser Geist solche immateriellen Beziehungen schafft, die er selbst und andere Geister zu erkennen vermögen, wurzelt er dennoch gleichzeitig ganz und gar in den physikalischen Prozessen, die seinem eigenen Wirken, dem anderer Geister und all jenen Ereignissen, die Teil einer Kommunikation sind, zu Grunde liegen. Es gibt keine zwei vollständig voneinander getrennten Domänen der Materie und des Geistes und keine Basis für einen Dualismus. Doch offenbar gibt es ein durch die physikalische (muss wohl heißen ‚physische’, d. Rez.) Ordnung von Gehirn, Körper und sozialer Welt geschaffene Sphäre, durch die Bedeutung geschaffen wird. Diese Bedeutung ist sowohl für unsere Beschreibung der Welt als auch für unser wissenschaftliches Verständnis von dieser unerlässlich. Es sind die unglaublich komplexen materiellen Strukturen des Nervensystems und des Körpers, aus denen dynamische mentale Prozesse und Bedeutung hervorgehen. Nichts anderes ist vonnöten (Hervorheb. v. Rez.) – keine anderen Welten oder Geister, auch keine außerordentlichen bislang unerforschten Kräfte wie die Quantengravität.“ (300 f.)
Geist, Bewusstsein ist Bedeutung und immateriell, das Gehirn ist physisch, wird durch die Naturwissenschaften Physik, Chemie und Biologie erforscht und ist materiell. Der Geist hat seine materielle Basis im Gehirn. Aber Geist ist nicht materiell wie die Autoren andeuten („wurzelt er doch ganz und gar in den physikalischen Prozessen“). Nur soweit Geist an Materie gebunden ist, Bedeutung ist, stimmen wir den Autoren zu. Geist oder Bewusstsein ist aber mehr als nur Bedeutung. Wenn die serielle Abfolge des dynamischen Kerngefüges (Cluster) im Gehirn zu einer Kohärenz der Bewusstseinszustände führt, eine Einheit des Bewusstseins entstehen lässt, gezielte Aufmerksamkeit, Planung usw. möglich sind, die durch Bedeutungen bestimmt sind, dann kann der Geist nicht nur Bedeutung sein, sondern muss selbst Einfluss nehmen auf die serielle Abfolge der dynamischen Kerngefüge, vor allem unter der Voraussetzung, die die Autoren explizit machen, dass immer nur ein dynamisches Kerngefüge aktuell wirksam sein kann (mit Ausnahme von Schizophrenie). Alle im Gehirn ablaufenden zielgerichteten Prozesse, und nur die sind evolutionär von Vorteil gewesen, setzen ein aktiv handelndes Selbst voraus, das nicht materiell sein kann. Denn dann müsste es selbst wieder solch ein Cluster sein, das wiederum von einem anderen Cluster angeleitet würde usw., was zu einem Progress ins Unendliche führte. Reflexion, Freiheit, Willensfreiheit, Kreativität, Denken von Zukünftigen, Planung, die einem Bewusstsein, Geist, Selbst oder Subjekt, das zielgerichtetes Denken und daraus fließende Handlungen steuert, zugestanden werden muss, kann nur immateriell gedacht werden. Seine Basis oder seine Spuren im Gehirn sind naturwissenschaftlich vielleicht erforschbar, seine Wirkung auf das materielle Gehirn und damit auf den übrigen Körper aber bleibt ein mysterium stricte dictum.
![]()
Hier können Sie Ihre Meinung äußern,
einen Beitrag in unser Gästebuch fomulieren,
Kritik üben oder
mit uns Kontakt aufnehmen...
Empfehlungen zu unserem Internetauftritt
Zu den letzten Artikeln unseres Webprojektes im Überblick:
Unser Internettagebuch/ Weblog:
Audios, Fotos und Videos über:
Alle Bücher des Vereins und die Zeitschrift "Erinnyen" gibt es in unserem Online-Buchladen:
Die letzten Ausgaben der "Erinnyen" im Internet zum kostenlosen Herunterladen:
Erinnyen Nr. 18
Copyright © Alle Rechte liegen bei den Erinnyen. Näheres siehe Impressum.
Datum der letzten Korrektur: 25.09.2008